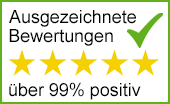Das Undenkbare tun. Juden in Deutschland nach 1945. Mit einer Einleitung der Verfasserin. Aus dem Amerikanischen von Georgia Hanenberg. – Buch gebraucht kaufen
Möchten Sie selbst gebrauchte Bücher verkaufen? So einfach geht's …
Verkäufer-Bewertung:
99,3% positiv (2627 Bewertungen)
dieses Buch wurde bereits 2 mal aufgerufen
dieses Buch wurde bereits 2 mal aufgerufen
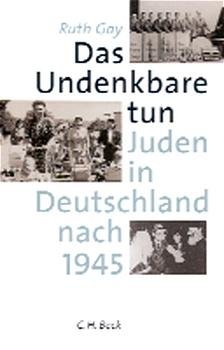
Preis:
11,00 €
*
Versandkosten: 2,70 € (Deutschland)
gebrauchtes Buch
Dieses Bild ist kein Original-Foto des angebotenen Exemplars. Abweichungen sind möglich.
* Inkl. Mwst.
Autor/in:
ISBN:
3406479723
(ISBN-13: 9783406479724)Verlag:
Gewicht:
580 g
Auflage:
Deutsche Erstausgabe.
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:
308 (4) Seiten mit 28 Abbildungen. 22,7 x 14,5 cm. Umschlaggestaltung: Atelier 59, Fritz Lüdtke. Blauer Pappband mit grün- und weißgeprägten Rückentiteln und Schutzumschlag.
Sehr guter Zustand. Neues Exemplar. Ungelesen. Was hat hunderttausende osteuropäische Juden nach dem Zweiten Weltkrieg dazu bewogen, sich in Deutschland niederzulassen? Wieso blieben die deutschen Juden, die den Holocaust überlebt hatten, im Land ihrer Henker? Warum kehrten zahlreiche vor dem Nazi-Terror geflüchtete Juden in ihre Heimat Deutschland zurück? Die in New York lebende Schriftstellerin Ruth Gay hat sich mit diesen Fragen auseinander gesetzt und präsentiert ein bisher wenig bekanntes Bild der Geschichte der Juden in Deutschland nach der Stunde Null. Es gehört zu den größten Ironien der Nachkriegsgeschichte, dass ausgerechnet Deutschland zum sichersten Zufluchtsort der überlebenden Juden wurde. Nur wenige wissen, dass die Juden aus Osteuropa in ihren Heimatländern einem wachsenden Antisemitismus ausgesetzt waren -- die Autorin verweist beispielsweise auf 2.000 Juden, die in den ersten beiden Jahren nach Kriegsende in Polen Opfer von Pogromen wurden. Da der Weg nach Palästina versperrt war und nur wenige Staaten Flüchtlinge aufnahmen, blieb nichts anderes übrig, als die Flucht in das von den Alliierten kontrollierte Deutschland. Eine Entscheidung also, die weniger auf rationalen Beweggründen beruhte, sondern vielmehr aus Mangel an Alternativen getroffen wurde. Gay beschreibt, wie sich in den Lagern für "displaced persons" eine eigene osteuropäische jüdische Kultur entwickelte, die aber nur von kurzer Dauer war. Bereits 1948 hatten die meisten Juden Deutschland wieder verlassen, da endlich Ausreisemöglichkeiten bestanden. Die verbliebenen knapp 12.000 osteuropäischen Juden gründeten zusammen mit den deutschen Juden die neuen jüdischen Gemeinden. Hier setzt die Autorin an und schildert den Neuaufbau, das Leben der Überlebenden in beiden Teilen Nachkriegsdeutschlands und die heutige Situation der neuen jüdischen Generation in Deutschland. Das Undenkbare tun ist ein beeindruckendes Zeitdokument über den Neubeginn der Opfer im Land der Täter. Die jüdische Kultur in Deutschland endete nicht 1945, sie wurde fortgeführt bis zum heutigen Tag. Zum Verständnis dieses besonderen Kapitels der jüdischen Geschichte hat Ruth Gay mit diesem Buch einen wichtigen Beitrag geleistet. --Christoph Reudenbach. - Ruth Gay (* 19. Oktober 1922 in New York City; † 9. Mai 2006 in New York) war eine US-amerikanische Bibliothekarin, Historikerin, Autorin und Journalistin. Leben: Ruth Gay, geborene Ruth Slotkin, zeitweise Ruth Glazer, war die älteste der drei Töchter von Harry Slotkin und Mary Pfeffer Slotkin. Ihr Vater war ein Milchverkäufer, der später einen Feinkost-Laden (Delicatessen) eröffnete (eine Art des Gewerbes, die später zum Thema ihres ersten Artikels werden sollte). Sie besuchte Schulen am jeweiligen Wohnort. Als die Familie von der Bronx in den Stadtteil Queens umzog, besuchte sie anschließend das Queens College, das sie 1943 mit einem Bachelor-Titel abschloss. Am College war sie Mitglied der Avukah-Vereinigung, einer links-zionistischen Studentenorganisation. Zwischen 1943 und 1948 arbeitete sie zunächst für verschiedene Gewerkschaften und Zeitschriften von Gewerkschaften als Autorin und Editorin. Ab dem Jahr 1946 schrieb sie „Human Interest“-Artikel über die zeitgenössische jüdische Kultur in der Bronx und in ganz New York, später mit einem Schwerpunkt über deutsch-jüdische Immigranten in den USA und Israel. Ihre ersten Artikel wie „The Jewish Delicatessen“ und „The World of Station WEVD“ erschienen in der Rubrik „American Scene“ der Zeitschrift Commentary. Im Jahr 1943 heiratete sie den Soziologen Nathan Glazer, mit dem sie drei Töchter hatte: Sarah (* 1950), Sophie (* 1952) und Elizabeth (* 1955). Glazer war seinerzeit ein Doktorand und wurde später Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift Commentary. 1958 ließ sie sich von Glazer scheiden; im Jahr 1959 heiratete sie den Historiker Peter Gay, der ihre drei Töchter adoptierte. Im Jahr 1969 schloss sie eine Ausbildung zur Bibliothekarin mit einem „Master of Library Science“ (M.L.S.) der School of Library Service der Columbia University ab. Von 1972 bis 1985 war sie einerseits als Historikerin tätig, andererseits arbeitete sie als Archivarin und Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek der Yale University. Im Jahr 1984 verbrachte sie drei Monate in Berlin, um dort das Archiv der West-Berliner Jüdischen Gemeinde neu zu strukturieren. Die letzten Jahre ihres Lebens lebte sie in Manhattan. Auseinandersetzung um Lea Rosh: Die Publizistin Lea Rosh klagte gegen die Auslieferung von Gays Buch über die Juden in Deutschland. Gay hatte dort beschrieben, dass sich vor allem Institutionen und engagierte Nichtjuden für ein Gedenken an die Opfer des Holocaust einsetzen. Lea Rosh hatte sie als Initiatorin des Holocaust-Mahnmals erwähnt und sie als Fernseh-Journalistin bezeichnet, „die sich einen trügerisch jüdisch klingenden (Vor-)Namen zugelegt hat, obwohl sie gar keine Jüdin ist“. Rosh klagte dagegen vergeblich. . . . Aus: wikipedia-Ruth_Gay.
Sehr guter Zustand. Neues Exemplar. Ungelesen. Was hat hunderttausende osteuropäische Juden nach dem Zweiten Weltkrieg dazu bewogen, sich in Deutschland niederzulassen? Wieso blieben die deutschen Juden, die den Holocaust überlebt hatten, im Land ihrer Henker? Warum kehrten zahlreiche vor dem Nazi-Terror geflüchtete Juden in ihre Heimat Deutschland zurück? Die in New York lebende Schriftstellerin Ruth Gay hat sich mit diesen Fragen auseinander gesetzt und präsentiert ein bisher wenig bekanntes Bild der Geschichte der Juden in Deutschland nach der Stunde Null. Es gehört zu den größten Ironien der Nachkriegsgeschichte, dass ausgerechnet Deutschland zum sichersten Zufluchtsort der überlebenden Juden wurde. Nur wenige wissen, dass die Juden aus Osteuropa in ihren Heimatländern einem wachsenden Antisemitismus ausgesetzt waren -- die Autorin verweist beispielsweise auf 2.000 Juden, die in den ersten beiden Jahren nach Kriegsende in Polen Opfer von Pogromen wurden. Da der Weg nach Palästina versperrt war und nur wenige Staaten Flüchtlinge aufnahmen, blieb nichts anderes übrig, als die Flucht in das von den Alliierten kontrollierte Deutschland. Eine Entscheidung also, die weniger auf rationalen Beweggründen beruhte, sondern vielmehr aus Mangel an Alternativen getroffen wurde. Gay beschreibt, wie sich in den Lagern für "displaced persons" eine eigene osteuropäische jüdische Kultur entwickelte, die aber nur von kurzer Dauer war. Bereits 1948 hatten die meisten Juden Deutschland wieder verlassen, da endlich Ausreisemöglichkeiten bestanden. Die verbliebenen knapp 12.000 osteuropäischen Juden gründeten zusammen mit den deutschen Juden die neuen jüdischen Gemeinden. Hier setzt die Autorin an und schildert den Neuaufbau, das Leben der Überlebenden in beiden Teilen Nachkriegsdeutschlands und die heutige Situation der neuen jüdischen Generation in Deutschland. Das Undenkbare tun ist ein beeindruckendes Zeitdokument über den Neubeginn der Opfer im Land der Täter. Die jüdische Kultur in Deutschland endete nicht 1945, sie wurde fortgeführt bis zum heutigen Tag. Zum Verständnis dieses besonderen Kapitels der jüdischen Geschichte hat Ruth Gay mit diesem Buch einen wichtigen Beitrag geleistet. --Christoph Reudenbach. - Ruth Gay (* 19. Oktober 1922 in New York City; † 9. Mai 2006 in New York) war eine US-amerikanische Bibliothekarin, Historikerin, Autorin und Journalistin. Leben: Ruth Gay, geborene Ruth Slotkin, zeitweise Ruth Glazer, war die älteste der drei Töchter von Harry Slotkin und Mary Pfeffer Slotkin. Ihr Vater war ein Milchverkäufer, der später einen Feinkost-Laden (Delicatessen) eröffnete (eine Art des Gewerbes, die später zum Thema ihres ersten Artikels werden sollte). Sie besuchte Schulen am jeweiligen Wohnort. Als die Familie von der Bronx in den Stadtteil Queens umzog, besuchte sie anschließend das Queens College, das sie 1943 mit einem Bachelor-Titel abschloss. Am College war sie Mitglied der Avukah-Vereinigung, einer links-zionistischen Studentenorganisation. Zwischen 1943 und 1948 arbeitete sie zunächst für verschiedene Gewerkschaften und Zeitschriften von Gewerkschaften als Autorin und Editorin. Ab dem Jahr 1946 schrieb sie „Human Interest“-Artikel über die zeitgenössische jüdische Kultur in der Bronx und in ganz New York, später mit einem Schwerpunkt über deutsch-jüdische Immigranten in den USA und Israel. Ihre ersten Artikel wie „The Jewish Delicatessen“ und „The World of Station WEVD“ erschienen in der Rubrik „American Scene“ der Zeitschrift Commentary. Im Jahr 1943 heiratete sie den Soziologen Nathan Glazer, mit dem sie drei Töchter hatte: Sarah (* 1950), Sophie (* 1952) und Elizabeth (* 1955). Glazer war seinerzeit ein Doktorand und wurde später Herausgeber der einflussreichen Zeitschrift Commentary. 1958 ließ sie sich von Glazer scheiden; im Jahr 1959 heiratete sie den Historiker Peter Gay, der ihre drei Töchter adoptierte. Im Jahr 1969 schloss sie eine Ausbildung zur Bibliothekarin mit einem „Master of Library Science“ (M.L.S.) der School of Library Service der Columbia University ab. Von 1972 bis 1985 war sie einerseits als Historikerin tätig, andererseits arbeitete sie als Archivarin und Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek der Yale University. Im Jahr 1984 verbrachte sie drei Monate in Berlin, um dort das Archiv der West-Berliner Jüdischen Gemeinde neu zu strukturieren. Die letzten Jahre ihres Lebens lebte sie in Manhattan. Auseinandersetzung um Lea Rosh: Die Publizistin Lea Rosh klagte gegen die Auslieferung von Gays Buch über die Juden in Deutschland. Gay hatte dort beschrieben, dass sich vor allem Institutionen und engagierte Nichtjuden für ein Gedenken an die Opfer des Holocaust einsetzen. Lea Rosh hatte sie als Initiatorin des Holocaust-Mahnmals erwähnt und sie als Fernseh-Journalistin bezeichnet, „die sich einen trügerisch jüdisch klingenden (Vor-)Namen zugelegt hat, obwohl sie gar keine Jüdin ist“. Rosh klagte dagegen vergeblich. . . . Aus: wikipedia-Ruth_Gay.
Stichwörter:
Erstausgabe / -auflage:
Erschienen:
2001.
Angebot vom:
21.03.2024
Bestell-Nr.:
72993
Lieferzeit:
Sofort bestellen | Anfragen | In den Warenkorb
Verwandte Artikel
Verkäufer/in dieses Artikels
Verkäufer/in
BOUQUINIST
(Deutschland,
Antiquariat/Händler)
>> Benutzer-Profil (Impressum) anzeigen
>> AGB des Verkäufers anzeigen
>> Verkäufer in die Buddylist
>> Verkäufer in die Blocklist
Angebote: Bücher (15963) | Hörbücher (3) | Tonträger (7)
>> Benutzer-Profil (Impressum) anzeigen
>> AGB des Verkäufers anzeigen
>> Verkäufer in die Buddylist
>> Verkäufer in die Blocklist
Angebote: Bücher (15963) | Hörbücher (3) | Tonträger (7)
Angebotene Zahlungsarten
- Offene Rechnung
(Vorkasse)
- Selbstabholung und Barzahlung
- Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten), nur bei Bestellungen von außerhalb der EU
Ihre allgemeinen Versandkosten
| Ihre allgemeinen Versandkosten gestaffelt nach Gewicht | |||
|---|---|---|---|
| Gewicht | Deutschland | EU | Welt |
| bis 1000 g | 2,70 € | 11,50 € | 19,50 € |
| bis 2000 g | 4,80 € | 11,50 € | 19,50 € |
| bis 5000 g | 8,00 € | 18,00 € | 50,00 € |
| bis 10000 g | 11,00 € | 23,00 € | 80,00 € |
| darüber | 21,00 € | 46,00 € | 210,00 € |
Bei gleichzeitiger Bestellung mehrerer Artikel bei diesem Verkäufer gilt für den Versand innerhalb Deutschlands: ab einer Bestellung von 2 Artikeln mit einem Gewicht von insgesamt zwischen 300 und 1000 Gramm betragen die Versandkosten mindestens 4,80 €
Regelungen zum Widerruf bzw. zur Rückgabe
Rückgaberecht
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
Florian Achthaler
Bouquinist-Versandantiqauariat
Nordendstr. 15
80799 München
Tel: 089 27399793
E-Mail: [email protected]
Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.
Ende der Rückgabebelehrung
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen durch Rücksendung der Ware zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. B. als Brief, Fax, E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie die Rückgabe auch durch Rücknahmeverlangen in Textform erklären. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu erfolgen an:
Florian Achthaler
Bouquinist-Versandantiqauariat
Nordendstr. 15
80799 München
Tel: 089 27399793
E-Mail: [email protected]
Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.
Ende der Rückgabebelehrung