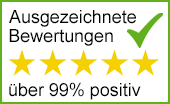Beschreibung:
Deutsche Besatzung Judenrettung Nationalsozialismus Sendler Irena Getto Erinnerungen Warschau zur Zeit der deutschen Besatzung Obwohl für die geringste Hilfeleistung gegenüber Juden die Todesstrafe droht, gelingt es der jungen Polin Irena Sendler, 2500 jüdische Kinder vor dem Tod zu bewahren. Als Krankenschwester hat sie Zugang zum Warschauer Ghetto. In Säcken und Kisten, mit Schlafmitteln betäubt, durch Keller und Abwasserkanäle schleust sie die Kinder auf die andere Seite des Ghettos. Mit gefälschten Papieren gibt sie ihnen eine neue Identität und verschafft ihnen in polnischen Familien, Waisenhäusern und Klöstern ein neues Zuhause. Als die Gestapo sie faßt und foltert, gibt sie keine Namen preis und kommt selbst nur knapp mit dem Leben davon. Die genauen Daten aller geretteten Kinder versteckt sie unter einem Apfelbaum in einem Garten. Auf der Grundlage persönlicher Aufzeichnungen und Erinnerungen der mittlerweile 95jährigen Irena Sendler erzählt die Journalistin Anna Mieszkowska ihre bislang fast unbekannte Geschichte Anna Mieszkowska, geboren 1958 in Warschau, ist Theaterwissenschaftlerin und Journalistin. Literatur Biografien Erfahrungsberichte Deutsche Besatzung Berichte Erinnerungen Judenrettung Nationalsozialismus Sendler, Irena Warschau Getto ISBN-10 3-421-05912-8 / 3421059128 ISBN-13 978-3-421-05912-3 / 9783421059123 Vorwort Dies ist das erste Buch über Irena Sendler. Es ist eigentlich mehr als ein Buch über sie. Obwohl es sich nicht einfach um ein langes Interview handelt, ist es zum überwiegenden Teil doch ihr Buch. Anna Mieszkowska lässt nämlich ihre Heldin zu Wort kommen, gibt ihre Meinung wieder, zitiert sie. Jahrelang waren ihre Taten relativ wenigen Menschen bekannt: jenen, denen sie das Leben gerettet hat, ihrem Freundes- und Bekanntenkreis sowie einigen Historikern, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg, vorwiegend mit der Geschichte der Massenvernichtung, befassen. Man konnte den Eindruck gewinnen, wir seien uns dessen nicht bewusst gewesen, oder wollten uns vielmehr dessen nicht bewusst werden, dass unter uns eine Frau mit einer so außergewöhnlichen Biografie lebt, obwohl im täglichen Leben bescheiden, herzlich, hilfsbereit und immer den Menschen zugewandt, die in Not geraten sind, eine Frau, mit der Umgang zu haben einfach Freude bereitet. Dass diese große Persönlichkeit an den Rand gedrängt wurde, hatte verschiedene Ursachen, darunter auch die wiederholte Verleugnung der neuesten Geschichte im kommunistischen Polen. Auf der Liste der Helden war einfach kein Platz für eine engagierte Frau, die zwar der Linken entstammte, doch von der ideologischen Utopie des Kommunismus weit entfernt war, die einer linken Bewegung angehörte, die in Polen eine große Tradition hat. Ins Spiel kam ferner, dass man seit den ersten Nachkriegsjahren in der Volksrepublik Polen alles, was auf die eine oder andere Weise mit Juden zusammenhing, für ein heikles, unsicheres und gefährliches Thema hielt, über das man besser schwieg. Dieses Phänomen verschärfte sich noch, als in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre der offizielle Antisemitismus aufkam, in dem sich Motive des Faschismus und des Stalinismus, den beiden schlimmsten Formen des Totalitarismus des 20. Jahrhunderts, verbanden. In einer Welt, in der eine solche Ideologie die Herrschaft über den Geist anstrebte, gab es keinen Platz für Irena Sendler. Es ist also kein Zufall, dass sie erst nach der Wende 1989 zu einer öffentlich anerkannten und viel gerühmten Person wurde. Das demokratische Polen weiß sie nämlich zu würdigen, wovon Auszeichnungen wie der ihr verliehene Orden des Weißen Adlers oder der Jan-Karski-Preis, benannt nach einer anderen herausragenden Persönlichkeit, die die Geschichte Polens im 20. Jahrhundert prägte, zeugen. Auch im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten, aber auch in Schweden, Deutschland und in vielen anderen Ländern, hat man die Bedeutung Irena Sendlers erkannt. Die Formulierung »Sendlers Liste« hält Einzug in die Sprache und hat gute Aussichten, die von Steven Spielbergs Film geprägte Formulierung »Schindlers Liste« zu übertreffen. Schließlich ist die Namensliste der von der Polin Irena Sendler geretteten Juden viel umfangreicher als die Liste jener, die der deutsche Industrielle Oskar Schindler gerettet hat. Anna Mieszkowskas Buch erzählt Irena Sendlers Geschichte präzise und detailliert, es schildert ihre Taten, ihre Arbeit und ihren Alltag, es zeigt ihre moralische Größe. Etwas so Großes zu leisten wie die Rettung von 2500 jüdischen Kindern während der Vernichtung und darüber hinaus zur Rettung einer beachtlichen Zahl von Erwachsenen beizutragen, dazu gehört viel menschliche Klasse. Um so etwas Einmaliges und Mutiges zu tun, und das in einer Situation, in der jede einem Juden geleistete Hilfe mit dem Tod bestraft wurde, musste man wahrlich über heldenhafte Tugenden verfügen. Das Bedürfnis, Gutes zu tun, reichte allein nicht aus, genauso wenig wie die Überzeugung, dort Hilfe zu leisten, wo sie so dringend erforderlich war; denn wer eine solche Aufgabe auf sich nahm, musste unglaublich mutig sein, er setzte nämlich sein Leben aufs Spiel - und das nicht nur einmal, wenn er eine mutige Tat beging, sondern ständig. Man muss hier fast schon von Aufopferung sprechen. Irena Sendler riskierte ihr Leben, um während der deutschen Besatzung Juden zu retten. Um so Großes zu vollbringen, reichten Mut und Charakterstärke allein nicht aus. Diese Tugenden waren verbunden mit einer außerordentlichen Energie, die sie entfalten musste, um die Kinder aus dem Ghetto herauszuholen und dann ein Versteck für sie zu finden an Orten, die eine Überlebenschance boten. Irena Sendler wusste, dass das Leben von Menschen, deren einzige Schuld darin bestand, kein »arisches Blut« zu haben, auf dem Spiel stand, und entfaltete angesichts dessen eine außerordentliche Energie und einen ungewöhnlichen Ideenreichtum. Und sie legte dabei ein verblüffendes Organisationstalent an den Tag. Einer allein hätte so viele Kinder niemals retten können. Das Buch von Anna Mieszkowska ist eine indirekte Huldigung an Irena Sendlers Mitarbeiter, bewundernswerte, unglaublich mutige und aufopferungsvolle Frauen. Ich sage es noch einmal: Irena Sendler ist in letzter Zeit eine öffentliche Person geworden, von der man in der Presse liest und im Rundfunk spricht, eine öffentliche Person, von der man in Dokumentarfilmen erzählt. Irena Sendler ist bereits jetzt ein Symbol des Heldentums und der Aufopferung - und sie hat beste Aussichten, auch zu einem Symbol für die guten und freundschaftlichen polnisch-jüdischen Beziehungen zu werden. Micha Glowiriski Irena Sendler im Frühjahr 2003 Irena Sendlers Geschichte war mir aus Presse- und Fernsehberichten bekannt. Als 2001 vier Schülerinnen einer amerikanischen Schule in Uniontown, Kansas, die Heldin des von ihnen verfassten Theaterstücks Holocaust. Leben im Glas in Warschau besuchten, riefen die Medien die damals 91-jährige Irena Sendler und ihre außerordentlichen Leistungen während des Zweiten Weltkriegs in Erinnerung. Sie ist die »Mutter« von 2500 aus dem Warschauer Ghetto geretteten Kindern. Ich benutze bewusst nicht das Wort »Pflegemutter«, sondern Mutter, denn sie hat ihnen das Leben zum zweiten Mal geschenkt. Im April 2003 kam Lili Pohlmann aus London zu den Feierlichkeiten des 60. Jahrestags des Warschauer Ghettoaufstands nach Warschau. Sie besuchte Irena Sendler im Pflegeheim des Klosters der Barmherzigen Brüder im Stadtteil Nowe Miasto. Sie war außerordentlich bewegt von dieser Begegnung. Es war für sie unfassbar, dass niemand es für angebracht hielt, diese bescheidene Frau zu würdigen, die es nicht zuließ, dass man von ihr als »Heldin« sprach, und die die von ihr geretteten Kinder »Helden mütterlicher Herzen« nannte. Lili Pohlmann sagte zu mir: »Du musst Irena Sendler kennen lernen und über sie schreiben.« Ich ging also zu ihr. Mir gegenüber sitzt, schwarz gekleidet, eine freundlich lächelnde alte Dame in einem bequemen Sessel und drückte sich sehr gewählt, fast literarisch aus. An den Wänden ihres kleinen Zimmers hängen sorgfältig gerahmte Diplome und Auszeichnungen. Und auf dem Tisch, in greifbarer Nähe, stehen Fotos ihrer Mutter, ihrer Eltern als Verlobte, ihrer Kinder und ihrer Enkelin. Außerdem ein aufwändig gerahmtes Bild der vier amerikanischen Schülerinnen aus Uniontown. Sie waren es, die mit ihrem Theaterstück die Geschichte der mutigen Polin in Erinnerung riefen und in nur zehn Minuten fünf Jahre Kriegsgräuel Revue passieren ließen. »Die Mädchen aus den fernen Vereinigten Staaten entdeckten dich für die Welt und für ... Polen«, sagt Sendlers Freundin Jolanta Migdalska-Barariska. »Ja, das stimmt. Das geschah nach Jahren der Schikanen, Erniedrigungen, Verfolgungen«, antwortet Irena Sendler traurig. Sie ist Literaturwissenschaftlerin und fühlte sich zur Sozialarbeiterin im weitesten und schönsten Sinn dieses Wortes berufen. Mein erster Besuch bei ihr dauert eineinviertel Stunden. Sie erzählt unter anderem: »Mein Vater starb, als ich sieben Jahre alt war. Aber ich prägte mir für immer seine Worte ein, dass man die Menschen in gute und böse einteilt. Nationalität, Rasse, Religion haben keine Bedeutung. Nur was für ein Mensch jemand ist. Der zweite Grundsatz, den man mir seit meiner Kindheit beibrachte, war die Pflicht, dem Ertrinkenden die Hand hinzustrecken, jedem Menschen, der in Not geraten ist. Ich bin 93 Jahre alt«, sagt Irena Sendler, »leide an dreißig Krankheiten und blicke auf sechzig Jahre meines geschenkten Lebens zurück. Seit über fünfzehn Jahren sitze ich im Rollstuhl. Ich mag keine Journalisten, denn sehr oft verdrehen sie das, was man ihnen erzählt. Immer wieder taucht in Interviews oder Berichten über mich die irrige Information auf, dass ich typhuskranke Kinder aus dem Warschauer Ghetto herausholte. Das zeugt von einer absoluten Unkenntnis der Lebensbedingungen im Ghetto. Typhuskranke Menschen, unabhängig davon, ob es Erwachsene oder Kinder waren, hatten praktisch keine Chance, gerettet zu werden. Solche falschen Informationen werden häufig verbreitet. Deshalb berichtige ich sie jetzt. Meistens halte ich mich an den Grundsatz, mit niemandem über das Ghetto zu sprechen, der nicht dort war, von meinem Aufenthalt im Pawiak-Gefängnis niemandem zu erzählen, der dort nicht inhaftiert war, und über den Warschauer Aufstand unterhalte ich mich nicht mit Leuten, die ihn nicht selbst erlebt haben. Über meine Erfahrungen zu berichten, ist sehr anstrengend für mich. Erinnerungen und Albträume kehren zurück. Noch heute träume ich davon, wie ich Eltern um Erlaubnis bitte, ihr Kind mitzunehmen. Aber auf die Frage, welche Garantien wir geben, konnte ich nur antworten, dass es keine Garantien gibt. Diese Träume verfolgen mich. Die Aufregung kostet mich viel Kraft. Mein Leben war alles andere als einfach. Ich habe viel erlebt. Auch viele persönliche Tragödien ... Ich habe eine Tochter, eine Schwiegertochter und eine Enkelin. Und sehr, sehr viele Freunde ... Zu mir kommen Menschen, die ich gerettet habe, aber auch deren Kinder und Enkel.« Bis heute interessiert sich Irena Sendler für vieles und hält sich auf dem Laufenden. Sie liebt Menschen, und sie liebt Blumen. Wer in einer schwierigen Lebenslage um Hilfe und Rat bat, hat immer ein gutes Wort und Unterstützung von ihr bekommen. In ihrem kleinen Zimmer herrscht häufig Gedränge. Es kommt vor, dass an einem Tag mehrere Leute sie besuchen kommen. Das strengt sie zwar an, aber sie kann nicht Nein sagen, wenn jemand sie konkret um Hilfe bittet. Sie ist bestens darüber informiert, was in der Welt und in Polen vor sich geht. Sie macht sich Sorgen wegen des Irak-Kriegs, wegen der zahlreichen Gefahren des immer bedrohlicher werdenden Terrorismus. »Ich bin Pazifistin«, erklärt sie. »Ich habe zwei Weltkriege erlebt, zwei Aufstände in Warschau. Ich kann mich nicht mit dem Tod unschuldiger Menschen abfinden, und die Leidtragenden sind die Kinder. Sie leiden am meisten darunter.« Auf den Vorschlag, gemeinsam ein Buch über ihr ungewöhnliches Leben zu schr


![gebrauchtes Buch – Anna Mieszkowska (Autor) – Die Mutter der Holocaust-Kinder Irena Sendler und die geretteten Kinder aus dem Warschauer Ghetto [Gebundene Ausgabe] Anna Mieszkowska (Autor), Urszula Usakowska-Wolff (Übersetzer), Manfred Wolff (Übe gebrauchtes Buch – Anna Mieszkowska (Autor) – Die Mutter der Holocaust-Kinder Irena Sendler und die geretteten Kinder aus dem Warschauer Ghetto [Gebundene Ausgabe] Anna Mieszkowska (Autor), Urszula Usakowska-Wolff (Übersetzer), Manfred Wolff (Übe](https://images.booklooker.de/s/9783421059123/Urszula-Usakowska-Wolff-%C3%9Cbersetzer-Anna-Mieszkowska-Autor+Die-Mutter-der-Holocaust-Kinder-Irena.jpg)
(Vorkasse)